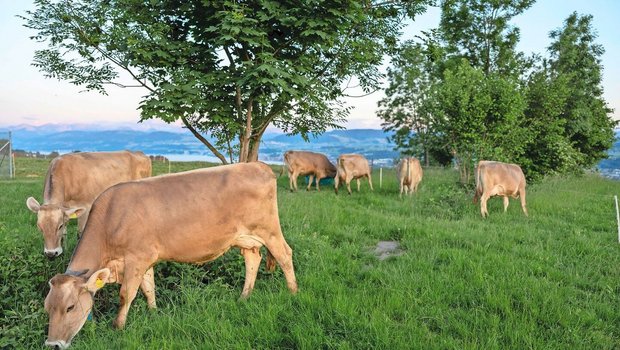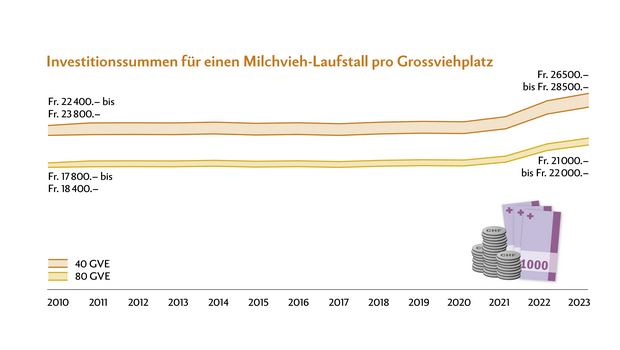Kurz & bündig
- Ausgangslage einer Milchgeldabrechnung ist die gelieferte Milch des letzten Monats sowie der geltende Milchpreis.
- Ausgehend davon werden Abzüge und Zuschläge gemacht.
- Zuschläge erhält der Landwirt zum Beispiel für gute Milchqualität oder für den Grünen Teppich.
- Abzüge für die Rohstoffverbilligung werden teils rückerstattet.
MilchproduzentInnen stellen keine Rechnung für die gelieferte Milch. Es funktioniert genau andersherum: Milchproduzenten erhalten monatlich eine Abrechnung von ihrem Milchabnehmer. Darauf sind etliche Abzüge und Zuschläge verbucht.
Auf den ersten Blick sieht es komplex aus. Anhand eines fiktiven Beispiels erklären wir die verschiedenen Posten einer Milchgeldabrechnung, die Produzent Max Muster für die Molkereimilch erhält.
Ausgangslage sind jeweils der Richtpreis für A-Milch sowie Entwicklungen auf dem internationalen Markt, die unter anderem den Preis für B-Milch beeinflussen. Der A-Richtpreis versteht sich exkl. Mehrwertsteuer und franko Rampe (ohne Transportkosten). Die Richtpreise enthalten die direkt an die Produzenten ausbezahlte Zulage für Verkehrsmilch.
Nach totaler Menge oder nach Inhaltsstoffen bezahlt
Die Preise werden mit der Menge Milch multipliziert, die Produzent Max Muster im letzten Monat geliefert hat.
Die Segmentierung in A- und B-Milch wird dabei aufgeschlüsselt, wobei das Verhältnis zwischen A- und B-Milch von der Produktpalette des Verarbeiters abhängt. Im A-Segment sind Milchprodukte mit hoher Wertschöpfung (Konsummilch, Konsumrahm, Butter Inland, Käse Inland). Im B-Segment sind Milchprodukte mit eingeschränkter Wertschöpfung respektive höherem Konkurrenzdruck (Quark, Joghurt Export, Milchmischgetränke).
Einige Abnehmer zahlen pro Kilogramm Milch, andere zahlen pro Kilogramm Fett respektive pro Kilogramm Eiweiss. In beiden Varianten dient der Richtpreis als Berechnungsgrundlage.
[EXT 1]
Bei der Qualitätsbezahlung soll kein Wettbewerb wirken
Für die Qualität der Milch ist der Produzent verantwortlich. Dazu verpflichten ihn öffentlich-rechtliche Verordnungen. Hinzu kommen teils privat-rechtliche Ergänzungen verschiedener Milchabnehmer, auf die hier nicht im Detail eingegangen werden kann. Grundsätzlich gilt für die allermeisten Milchproduzenten folgende privat-rechtliche Branchenvereinbarung, welche strenger ist als die öffentlich-rechtliche:
- Keimzahl < 60'000 pro ml Milch
- Zellzahl < 300'000 pro ml Milch
- Keine Hemmstoffe
- Gefrierpunkt bei –0,515 Grad
Auf diese Vereinbarung hat sich die Branche geeinigt, weil bei der Qualitätsbezahlung kein Wettbewerb zwischen einzelnen Milchabnehmern wirken sollte. Ganz nach dem Motto: Qualität ist nicht verhandelbar.
Werden die vier Qualitätsparameter nicht erfüllt, kommt es zu Abzügen und im mehrmaligen Wiederholungsfall schliesslich zur Milchsperre. Umgekehrt gilt: Erreichen alle vier Qualitätsparameter ausgezeichnete Werte, erhält der Produzent 0,5 Rappen Zuschlag pro Kilogramm Milch.
Saisonale Abzüge werden in den Vertrag geschrieben
Das Angebot von Milch schwankt naturbedingt über das Jahr. Im Frühling, wenn das Gras wächst, gibt es viel Milch auf dem Markt. Umgekehrt nimmt die Milchmenge gegen den Winter hin ab. Verstärkt wird diese Saisonalität mancherorts durch die Alpung der Kühe. Deren Milch fehlt dann im Tanklastwagen im Tal.
Um diese Saisonalität auszugleichen, gibt es Abzüge respektive Zuschläge: Im Frühling wird den ProduzentInnen Geld abgezogen, welches sie dann im Herbst wieder erhalten. Belohnt werden damit Betriebe, die nicht alle Kühe im Frühling kalben lassen und die mit dem Vieh nicht z Alp gehen. Betriebe also, die tendenziell asaisonal Milch produzieren.
Die saisonalen Abzüge und Zuschläge werden zwischen Produzenten und Abnehmern ausgehandelt. Das Resultat dieser Verhandlung wird im Milchkaufvertrag jeweils für das nächste Jahr festgehalten.
Bei den Transportkosten gibt es verschiedene Abrechnungssysteme:
- Pro Halt des Tanklastwagens auf dem Betrieb kostet es einen bestimmten Betrag. Ist die Pumpmenge jedoch über einem gewissen Wert, erhält der Produzent Geld zurück. Belohnt wird also, wer viel Milch liefert.
- Die Transportkosten werden auf die zurückgelegte Strecke ausgerechnet. Belohnt wird, wer einen zentral gelegenen Betrieb hat, der an der Sammelroute des Abnehmers liegt.
Abzüge zum Schutz der Schweizer Milch im Ausland
Zuletzt sind die Abzüge für die Absatzförderung aufgelistet. Hier wird es richtig kompliziert und auch etwas umständlich. Es geht um die Verkehrsmilchzulage, die Produzent Max Muster vom Bund direkt ausgezahlt erhält. Gleichzeitig ist die Verkehrsmilchzulage im Richtpreis inbegriffen – würde also doppelt ausgezahlt. Doch der Milchabnehmer zieht aktuell 4,5 Rappen ab und zahlt sie in die Fonds der Branchenorganisation Milch ein. Der Fonds «Rohstoffverbilligung Nahrungsmittelindustrie» wird zur Unterstützung von Exporten von milchhaltigen Produkten aus der Schweizer Nahrungsmittelindustrie wie zum Beispiel Schokolade verwendet.
Unter dem Strich ist dieses Hin- und Herschieben von Geld für den Milchproduzenten ein Nullsummenspiel: Auf der Milchgeldabrechnung wird ein Betrag abgezogen, welcher dann vom Bund in Form der Verkehrsmilchzulage rückerstattet wird – wobei diese Rückerstattung auf der Milchgeldabrechnung nicht ersichtlich ist.
Wenn das Geld aus dem Fonds zur Rohstoffverbilligung nicht ausreicht, zahlt der Produzent zusätzlich eine «vertikale Finanzierung» – die nicht rückerstattet wird. Wäre diese Zusatzfinanzierung nötig, wäre dies auf der Milchgeldabrechnung ebenfalls ausgewiesen. Im Beispiel von Max Muster ist die Marktlage aber günstig und es ist daher kein zusätzlicher Abzug nötig.
Abzüge zum Schutz der Schweizer Milch im Inland
Schliesslich kann für die sogenannte Importabwehr ein letzter Abzug gemacht werden (in unserem Abrechnungsbeispiel fehlt er). Im Gegensatz zum Fonds und zur «vertikalen Finanzierung» geht es hierbei nicht um exportierte Milch, sondern um die Verbilligung im Inland: Die Importabwehr verbilligt beispielsweise den Schweizer Mozzarella, damit er gegen die italienische, billigere Konkurrenz eine Chance hat und vom Detailhändler ins Regal gelegt wird.
Dieser Abzug wird nicht rückerstattet und geht somit zulasten der Produzenten. Er verbilligt somit ein Produkt im A-Segment, welches aber den A-Preis nicht lösen kann.