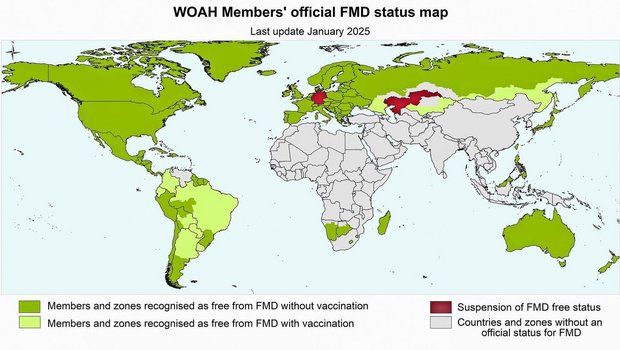Kurz & bündig - Kälber brauchen neben bedarfsgerechter Fütterung viel Wärme, Luft und Licht. - Eine Reduktion der Schadgase kann durch häufige Entmistung und durch Frischluftzufuhr gewährleistet werden. - Zugluft (> 0,2 m/sec) muss vermieden werden. - Die Wohlfühlzone für Kälber bis 150 kg Körpergewicht liegt bei 15 bis 20 Grad. - Sobald der Pansen gut funktioniert, gibt er Wärme ab und kann als innere Heizung…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 7 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.