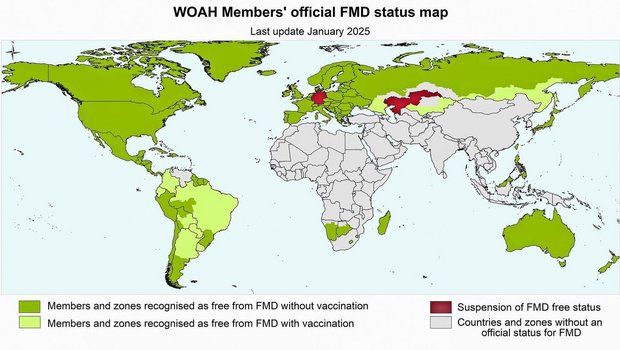Inwiefern hat sich ammengebundene Kälberaufzucht in der Schweiz durchgesetzt? Claudia Schneider: Zu Beginn waren es nur sehr wenige und man kannte die einzelnen Betriebe. Mittlerweile ist es schwierig, eine genaue Anzahl zu nennen, ich höre aber regelmässig von Betrieben, die neu damit angefangen haben. Von Durchsetzung zu sprechen, ist schwierig, in der Praxis findet das Thema aber zunehmend Interesse. Welche…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.