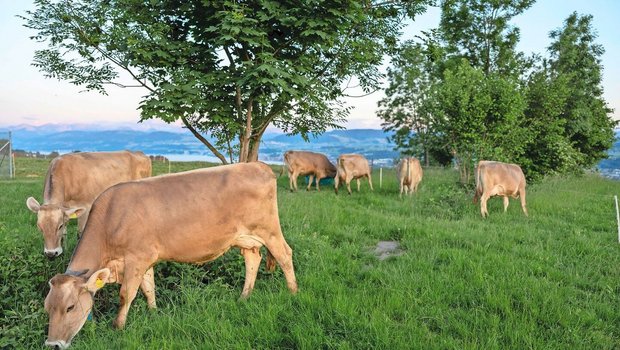Kurz & bündig
- Der Lely Astronaut A5 bei der Familie Baumberger ist in der I-Flow-Aufstellung platziert.
- Die Kühe gehen geradeaus in den Melkstand und wieder hinaus.
- Die Kuh bleibt beim Melken nahe bei der Herde. Der lasergesteuerte Melkarm schwenkt zur Melkbox im Stall.
Lely hat den Melkroboter auf dem Betrieb von Franziska und Daniel Baumberger in Wiggiswil BE in der I-Flow-Aufstellung montiert. Die Kühe können vom Laufgang zwischen zwei Boxenreihen und vom Laufgang zwischen der Boxenreihe und dem Fressgitter zum Melkroboter gelangen. Sie müssen nicht von der gleichen Ecke aus in den Melkstand treten – was bei grosszügigen Platzverhältnissen natürlich auch funktioniert.
Bei der I-Flow-Aufstellung beträgt das freie Umfeld beim Melkrobotereingang 270 Grad, ein Viertel mehr als bei einer konventionellen Anordnung an der Stirnwand.
Dadurch entsteht für die Kühe ein grosszügigeres Raumgefühl, was speziell rangschwachen Tieren einen Vorteil bringt. Und dies, ohne zusätzliche Flächen zu schaffen. «Wir wollten für die Kühe die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, damit sie sich frei bewegen können und der freie Tierverkehr perfekt funktioniert», erklärt Daniel Baumberger.
Die Kühe bewegen sich im Stall, wie sie wollen: Sie fressen, gehen in den Laufhof sowie zum Melken und werden einige Stunden geweidet. Die Hauptfütterung ist aber eine Total-Misch-Ration (TMR).
Seit Februar 2020, als auf dem Betrieb der Familie Baumberger der Lely Astronaut A5 in Betrieb genommen wurde, haben sich die Kühe wie erhofft verhalten. Sie suchen den Melkroboter regelmässig auf. «Einige natürlich auch zu oft, da sie sich ein Häppchen Kraftfutter erhoffen», schmunzelt Franziska Baumberger.
[IMG 1]
MelkroboterLely Astronaut A5 mit T4C-Managementprogramm
Auch Marc Grüter, der als Lely-Verkaufsberater am Umbau beteiligt war, freut sich am Ablauf im Stall. Auf dem Lely-Managementprogramm T4C (Time4Cow = Zeit für die Kuh) prüft er die aktuellsten Zahlen.
Zufrieden stellt Grüter fest, dass die Kühe trotz Weidegang durchschnittlich 2,5 Melkungen erreichen und vier bis fünf Mal zusätzlich zu früh zum Melkroboter kommen (Verweigerungen). «Das sind gute Zahlen, die auf einen idealen freien Kuhverkehr hinweisen.»
Die Melkroboter-Daten decken sich mit den Beobachtungen von Franziska und Daniel Baumberger. Die Kühe gehen täglich acht bis zehn Mal zum Fressgitter. Jedes zweite Mal wählen sie also den Weg durch den Melkroboter, die übrigen Male gehen sie direkt.
«Der Lely Astronaut ist eigentlich eine Kraftfutterstation, welche die Kuh in der Herde melkt. Weil der Melkroboter so offen wie möglich gebaut ist, kommen die Kühe freiwillig und ohne gedrängt zu werden, zum Melken. Der gerade Eingang und Ausgang und der grosszügige Platz in der Box steuern sicher viel zum erfolgreichen Besuchsverhalten bei», ergänzt Lely-Verkaufsleiter Marcel Schwager.
[IMG 3]
Mit dem MelkroboterLely Astronaut A5 läuft es wie erhofft
Die Planung eines Stalls rund um ein automatisches Melksystem ist immer eine theoretische Angelegenheit, die bei Lely Schweiz aber auf viel praktischer Erfahrung basiert. «Wir freuen uns immer, wenn wir einen Neu- oder Umbau bestmöglich planen dürfen», fügen Grüter und Schwager an.
Dennoch muss sich jedes Projekt in der Praxis bewähren, vor allem bei einem Umbau. Bei Baumbergers entspricht der Ablauf im Stall den erwünschten Vorstellungen. Mit ihren 52 Milchkühen kommt der Roboter gut zurecht und es bleibt genügend Zeit, dass auch rangniedrigere Tiere ihre Melkzeit finden.
Die Kühe haben sich rasch an den Melkroboter gewöhnt und es gab kaum Nervosität in der Herde. «Am nervösesten war ich», schmunzelt Daniel Baumberger.
Die Familie nahm den fertig installierten Melkroboter deshalb bewusst erst nach den Skiferien im Februar 2020 in Betrieb. Eine Woche Angewöhnungszeit erschien ihnen zu wenig, um unbeschwert zu verreisen. So hat der Lehrling weiterhin im Tandem-Melkstand gemolken. Die Kühe wurden in dieser Zeit an den Lely Astronaut gewöhnt, indem ihnen dort das Kraftfutter verabreicht wurde.
«Das hat sich sehr bewährt. Als wir anschliessend mit dem Melken starteten, war die Box den Kühen bereits bekannt und das zusätzliche Melken machte keinen grossen Unterschied mehr.»
Zum problemlosen Start dürfte auch die Bauart des Lely-Melkroboters beigetragen haben. Dieser besteht aus zwei Teilen. Einerseits der Melktechnik im Melkraum und anderseits dem Melkarm, der in den Stall, zur Herde hinaus geht, um das Melkzeug anzusetzen.
Das kann man sich vorstellen, als stehe am Rande des Laufgangs ein Behandlungsstand. In diesen gelangen die Kühe von hinten hinein und verlassen ihn wieder geradeaus an der Front. Dadurch sind die Kühe in Baumbergers Stall auf der rechten Seite nur durch Rohre von den übrigen Kühen getrennt. Ansonsten haben sie eine freie Sicht in den Stall. «Das ist ein wichtiger Aspekt, hier kommt man dem Tierverhalten besonders entgegen, da Kühe nicht gerne von der Herde abgesondert sind», erklärt Marcel Schwager.
[IMG 4]
Direkter elektrischer Antrieb des Melkroboters reduziert den Energiebedarf
Der Hybridarm wird pneumatisch und elektrisch bewegt. Der direkte elektrische Antrieb ist effizienter, als damit Druckluft zu bewegen, und er lässt sich leichter regeln. Der Druckluftzylinder wird zudem dafür genutzt, den Arm auf richtiger Höhe in der Schwebe zu halten und in den Melkstand zu schwenken.
Die präzise Feinsteuerung, um die Melkbecher anzusetzen, erfolgt direkt elektrisch. Geregelt werden die Bewegungen mit 3D-Lasertechnik. Das mehrschichtige Laserverfahren soll für das Ansetzen in schmutziger Umgebung besonders gut geeignet sein. Deshalb hat Lely das Verfahren beim Lely A5 weiter optimiert und diesen so zum schnellsten Melkroboter beim Anhängen gemacht.
Die Familie Baumberger hat an den Lely-Melkroboter hohe Ansprüche gestellt. Er musste einen bestehenden 7er-Tandem-Melkstand ersetzen. Dieser stand im alten Stallgebäude und war durch den Laufhof mit dem Boxenlaufstall verbunden. Jetzt ist der Melkroboter im Boxenlaufstall integriert.
«Wir raten davon ab, den Roboter in einem separaten Gebäude zu platzieren. Die Wege sollten kurz und unter dem gleichen Dach sein. Ansonsten meiden die Kühe, je nach Witterung, den Weg zum Roboter», so Verkaufsberater Marc Grüter.
Damit das automatische Melksystem im bestehenden Boxenlaufstall Platz fand, mussten vier Boxen entfernt werden. Das gefiel Daniel Baumgartner zunächst gar nicht. Heute ist er froh darüber.
Und er weiss jetzt schon, dass er trotz des Verzichts der vier Kuhplätze bis Ende Jahr nicht weniger Milch produzieren wird. Es ist besser, den Kühen mehr Platz zu geben, als jede Ecke zu verbauen. Haben sie mehr Platz, sind sie entspannter und produzieren mehr Milch.
Familie Baumberger pflegt einen liebevollen Umgang mit ihren Milchkühen. Deshalb war ihnen das Zusammentreiben der Herde in den Warteraum vor dem alten Melkstand schon lange ein Dorn im Auge.
«Zusammen mit dem neuen Melksystem war es unser Wunsch, dass die Kühe so viel wie möglich selbst bestimmen können. Wir wollten die Tiere nicht mehr länger ‚herumschieben‘, was für sie nicht angenehm ist», erklärt Franziska Baumberger.
Die Sensibilität der Familie Baumberger ist auch geprägt durch Erfahrungen mit Kriechstrom-Problemen an der bisherigen Melkeinrichtung. Viele Tiere wurden dadurch stark beeinträchtigt und fühlten sich unwohl. Daniel Baumberger erzählt, dass sich die Kühe manchmal geduckt hätten, als wäre über ihnen ein Draht gespannt. Oder sie blieben stehen wie vor einer unsichtbaren Wand.
Der unzumutbare Zustand für Mensch und Tier wurde etwas besser, als im Dorf der Transformer gewechselt wurde. Ganz gelöst wurde das Problem aber nicht. Erst jetzt, mit dem Melkroboter am neuen Standort, wurde es für die Kühe besser.
[IMG 5]
Hygiene im Melkstand sorgt für saubere Klauen
Die neue Betriebssituation ist für Daniel Baumberger wie eine Erlösung. Und er ist froh, haben sie sich für diesen Schritt entschieden. Der Erfolg zeigt sich auch an den Kühen. Litten bisher 75 Prozent ihrer Tiere an Mortellaro, seien es heute nur noch 10 Prozent, erzählt Baumberger erleichtert.
Die Betriebsleiter sind mit der neuen Betriebssituation stark entlastet. Vorher war es schon nur ein grosser Druck, die Milch morgens rechtzeitig für den Transport gemolken zu haben, weil wegen dem Kriechstrom nicht immer alles zügig abgelaufen ist.
Bei der Ausstattung des Melkroboters war es aufgrund der Mortellaro-Problematik keine Frage, dass die optionale Klauendusche dabei sein muss. Dort werden die Klauen von hinten gereinigt und desinfiziert. Damit wird die Krankheit nicht geheilt, aber der Ausbruch gehemmt.
In die Melkroboter-Box ist auch eine Tierwaage integriert, um Gewichtsveränderungen zu erkennen. Kommt es hier zu unüblichen Veränderungen, wird dies dem Tierhalter im T4C-Managementprogramm angezeigt.
Im Anschluss an den Boxenausgang ist ein Dreiwegtor montiert. Dort gehen die Tiere normalerweise zurück in den Stall, in die Abkalbebucht oder in die Trockensteller-Herde. Dort werden die Kühe auch für Behandlungen und die Trächtigkeitskontrolle separiert. Soll eine Kuh nach dem Melken selektioniert werden, lässt sich dies im Programm entsprechend planen.
«Wir stellen die Kühe nicht auf einmal trocken, sondern reduzieren die Melkungen. Diese Kühe kommen in die Trockensteller-Herde, wo sie gezielt von Hand zum Melken geführt werden», so Daniel Baumberger.
Das Stallabteil ist so konzipiert, dass alle Tiere einen Kontakt zum Rest der Herde haben. Sind die Kühe trockengestellt, kommen sie in den hinteren Teil des Stalls, wo sie an der gleichen Futterachse mit einer eigenen Mischration gefüttert werden.
Am Morgen werden die Kühe drei Stunden geweidet. Dabei müssen sie eine Strasse überqueren, weshalb die ganze Herde auf einmal raus und wieder rein kommt. Ein Weidetor, das den Kühen nach dem Melken automatisch den Zugang zur Weide gewährt, lässt sich dadurch nicht einrichten.
Trotz Umbau eine moderne Lösung mit Melkroboter gefunden
Obschon der Einbau des Melkroboters in ein bestehendes Gebäude erfolgte, musste die Familie Baumberger nur kleine Kompromisse eingehen. Könnte man von Grund auf neu planen, würde der Fressgang neben dem Melkroboter etwas breiter gebaut. Wegen der Gebäudekonstruktion konnte der Melkroboter nicht weiter zur Stallmitte verschoben werden, was noch mehr Abstand zur Fressachse gegeben hätte.
Der definitive Entscheid, weiterhin auf die Milchproduktion zu setzen, fiel auf einer Reise nach Holland, wo Baumbergers einige Melkroboter-Ställe besichtigten.
Besonders die I-Flow-Aufstellung hat sie begeistert. «Ich hatte ein sehr gutes Gefühl», erinnert sich Franziska Baumberger. Noch auf der Rückreise diskutierten sie Varianten, dieses Konzept auf dem eigenen Betrieb umzusetzen.
Die definitive Planung erfolgte mit den Lely-Spezialisten. Die Planungen für den Umbau begannen im Sommer 2019. Bei der Umsetzung musste in erster Linie massiver Beton bei den vier Boxen entfernt werden. Am Gebäude des Boxenlaufstalls aus dem Jahr 2000, waren keine wesentlichen baulichen Veränderungen notwendig.
Baumbergers sind froh, haben sie sich für den Fortbestand der Milchproduktion auf ihrem Betrieb entschieden. Und die Produktion läuft gut. Das sieht man ihnen und ihren zutraulichen Kühen an.
Betriebsspiegel der Familie Baumberger
Daniel und Franziska Baumberger, Wiggiswil BE
LN: 38 ha
Kulturen: Silomais, Futterweizen, Kunstwiese, extensive Wiese
Tierbestand: 52 Milchkühe (Red Holstein, Holstein, Montbéliard und Schweizer Fleckvieh)
Arbeitskräfte: Familienbetrieb, 1 Lehrling
Die Lely-Tierwaage
Die Lely-Tierwaage misst täglich das Gewicht der Kühe. Der Gewichtsverlauf erlaubt zusammen mit dem Fett- und Eiweissgehalt einen Rückschluss auf einen möglichen Fettabbau. Gemäss Lely handelt es sich um das frühestmögliche Warnsystem vor Ketose. Dadurch kann die Fütterung angepasst werden, bevor allenfalls Ketosekörper freigesetzt werden. Also Vorbeugen statt Heilen.
Weitere Daten die der Roboter ermittelt und der Landwirt täglich kontrolliert sind:
- Milchtemperatur
- Wiederkau- und Brunst-Aktivität
- Fressminuten
- Milchfarbe
Der Lely Astronaut A5 Melkroboter kostet je nach Ausstattung zwischen 160 000 und 240 000 Franken.
Die Melkroboter-Serie
Die Vorteile eines Melkroboters sind Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und flexiblere Arbeitszeiten. «die grüne» porträtiert die wichtigsten Hersteller.
- Lely, DeLaval, GEA & Co.: Von der ersten Melkmaschine zum Melkroboter (Mai 2020)
- Der DeLaval VMS 310 ist so schlau wie ein Smartphone (Juni 2020)
- Der Lely Astronaut A5 melkt mitten in der Herde (Juli 2020)
- GEA (August 2020)
- Lemmer Fullwood (September 2020)
- System Happel (Oktober 2020)
- Boumatic (November 2020)
Alle Beiträge lesen Sie im neuen Melkroboter-Dossier auf unserer Website.