[IMG 2]
Frau Bundesministerin Köstinger, Sie sind als Bauerntochter in Kärnten aufgewachsen. Also im südlichsten österreichischen Bundesland an der Grenze zu Italien und Slowenien. Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Kärnten hat sich seit 1945 halbiert. Heute gibt es noch 17'000 Betriebe. Ihre Familie konnte den Betrieb halten. Können Sie uns beschreiben, wie der Zogglhof der Familie Köstinger aussieht?
Elisabeth Köstinger: Unsere Familie bewirtschaftet in St. Paul den Zogglhof, einen Bio-Betrieb mit zwölf Hektar Grünland und Acker sowie acht Hektar Wald. Den Betrieb führt heute meine Schwester Martina.
St. Paul liegt auf 400 m ü. M. und ist eingebettet in die Hügel und in die fruchtbare Landschaft des unteren Lavanttales, wo im Frühling eine halbe Million Apfelbäume blühen.
Meine bäuerliche Herkunft hat mich stark geprägt. Geprägt hat mich auch, dass sich unsere Familie bewusst aus dem herrschenden Wettbewerb rausgenommen hat. Es heisst immer, es haben nur Landwirtschafts-Betriebe eine Zukunft, die mit dem Tempo mitgehen.
Wir haben stattdessen geschaut: Was sind alternative Märkte? Was wollen die Konsumenten? Und welche Art zu arbeiten und zu wirtschaften ist für uns als Familie gut?
Ich habe leider oft zuschauen müssen, dass sich Bauern-Familien die Ziele zu hoch stecken. Der Betrieb zerbricht dann, weil die Familie dem Druck nicht standhalten kann. Oder die Bauern-Familien machen etwas, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und das schafft auf die Dauer kein Landwirtschafts-Betrieb.
Was hat die junge Elisabeth damals auf dem Zogglhof gearbeitet? Was musste sie machen? Und was hat sie am liebsten gemacht?
Ich musste schon als Kind überall mitarbeiten, weil mein Opa einen Schlaganfall erlitt. Wir wurden deshalb als Kinder früh im Betrieb eingespannt. Zuerst musste ich die Kühe melken, später die Schafe. Ich glaube, ich kann heute noch im Schlaf alles melken, was Milch gibt (Elisabeth Köstinger lacht herzhaft).
Dabei war die Tierhaltung nur ein Nebenschauplatz. Bei uns stand die Obst-Verarbeitung im Mittelpunkt: Im Herbst mussten wir zum Beispiel die Äpfel pflücken und zu Most verarbeiten. Wir haben uns gegenseitig geholfen und solange gearbeitet, bis die Arbeit getan war. Auch das hat mich stark geprägt.
Heute wird oft darüber diskutiert, was zumutbar ist. Ich glaube, es wäre nicht nur für Bauern-Kinder wichtig, dass sie in die Erde greifen und arbeiten lernen.
Hatte Ihre Familie immer schon die Obst-Verarbeitung als Haupt-Betriebszweig?
Vor dem österreichischen EU-Beitritt 1995 bewirtschaftete unsere Familie einen klassischen österreichischen Gemischt-Betrieb. Wir hatten ein paar Milchkühe, Schweine und Hühner. Mit dem EU-Beitritt von Österreich haben wir uns die Frage gestellt: Wie kann das in Zukunft funktionieren?
Wir haben aber keinen Quadratmeter dazu gekauft. Meine Eltern haben stattdessen den Betrieb spezialisiert. Mit einem Partner-Betrieb stellten wir zuerst auf Milchschaf-Haltung um. Und später spezialisierten wir uns auf die Obst-Verarbeitung.
Bei uns sind noch alte Obst-Sorten heimisch: Bohnapfel, Marschansker, Brünnling, Renetten und der Lavanttaler Bananenapfel. Diese seltene Sorte kommt ursprünglich aus dem Osten der USA. Die Bananenäpfel sind süss, sehr aromatisch – und heissen so, weil sie bananenartig schmecken.
Als meine Eltern 1993 auf die Most-Produktion setzten, war Apfelwein ein Arme-Leute-Getränk. Der Most war im doppelten Sinne des Wortes im Keller. Jeder Landwirt hatte dort seinen Most. Aber wenn er Gäste bewirtete, wurde Bier oder Wein ausgeschenkt.
Die Vision meines Vaters war, aus den lokalen alten Obst-Sorten wertige Getränke zu kultivieren. Unsere Familie hat sich dafür von der traditionellen Most-Produktion wegbewegt und produziert zum Beispiel den Apfelwein wie einen Weisswein. Das Resultat sind zehn Obst-Produkte, von Apfelwein über Apfel- und Birnensäfte bis hin zu Likören. Echte Mostbarkeiten.
Die Milchschaf-Haltung haben wir in der Zwischenzeit wieder weggegeben. Unser Partner-Betrieb führt diese mit einem anderen Betrieb weiter. Wir haben uns stattdessen auf Pinzgauer Mutterkühe spezialisiert. Weil ohne Viecher auf einem Bauernbetrieb geht es ja auch nicht.
Auf dem Zogglhof der Familie Köstinger läuft vieles anders. Nur von der Grösse her ist es ein typischer Kärntner Bauernhof. Denn mit rund 8,5 Hektar Betriebsgrösse ist die Kärntner Landwirtschaft noch kleiner strukturiert als in der Schweiz. Haben diese kleinen Betriebe eine Überlebenschance? Oder müssen weiterhin jedes Jahr ein bis zwei Prozent der Kärntner Landwirte ihren Betrieb aufgeben?
Es ist auch in der Landwirtschaft extrem wichtig, zu differenzieren: Wir haben in Österreich Gross-Betriebe, die sehr effizient sind. Diese haben einen hohen Technisierungs-Grad und können im Wettbewerb mit grösser strukturierten Agrar-Ländern mithalten.
Daneben haben wir Klein-Betriebe, die sich ein eigenes Markt-Segment geschaffen haben. Sie haben sich spezialisiert, produzieren für die Direktvermarktung oder bieten Urlaub auf dem Bauernhof an. Diese Klein-Betriebe haben sich von den Agrar-Märkten abgekoppelt. Wenn zum Beispiel der Milchpreis sinkt, sind viele Direktvermarkter davon nicht mehr betroffen.
Das grosse Problem in der österreichischen Landwirtschaft sind die durchschnittlich grossen konventionellen Betriebe. Die sind zum Aufhören zu gross und zum Weitermachen zu klein.
Für diese Betriebe müssen wir in der Agrar-Politik echte Lösungen und Antworten finden: Was ist das Potenzial dieser Betriebe? Was ist in der jeweiligen Region möglich? Wie können wir über Kooperationen die Wertschöpfung erhöhen?
Auf einem Kärntner Landwirtschafts-Betrieb arbeiten im Schnitt zwei Beschäftigte. 67 Prozent der Betriebe werden im Nebenerwerb geführt. Ist das historisch bedingt oder schon eine Auswirkung des Strukturwandels?
Dafür sind beide Gründe verantwortlich, die Vergangenheit und der Strukturwandel. Dort, wo wir einen starken Tourismus haben, ist der Nebenerwerb eine gute Gelegenheit, einen kleinen Landwirtschafts-Betrieb in die Zukunft zu führen.
Das sehe ich nicht negativ. Es ist eine grosse Chance, weil die Verbundenheit unserer Landwirte zu ihrem Grund und Boden sowie zu ihren Tieren sehr gross ist.
Über ganz Österreich gesehen, haben wir erstaunlicherweise den grössten Strukturwandel in den Ackerbau-Gebieten. Mehr als in Berg-Gebieten und anderen Regionen mit einer klein strukturierten Landwirtschaft. Wie ich schon gesagt habe: Kleine Strukturen müssen kein Nachteil sein, es ist eine zusätzliche Chance.
Kommen wir vom Landwirtschafts-Betrieb in Kärnten auf die politische Bühne in Wien. Ist es für Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ein Vorteil oder ein Nachteil, dass sie eine bodenständige Bauerntochter aus Kärnten ist?
Es ist generell ein grosser Vorteil, wenn man als Ministerin mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und wenn man vor allem auch tief verwurzelt ist. Das hilft mir nicht nur als Landwirtschafts-Ministerin. Es wird immer ein grosser Vorteil in meinem Leben bleiben.
Im Gegensatz zum Schweizer (Land-)Wirtschaftsminister sind Sie nicht für alle Wirtschafts-Zweige verantwortlich, sondern «nur» für Landwirtschaft, Umwelt und Tourismus. Welchen Vorteil hat diese Fokussierung?
Grundsätzlich ist es ein Vorteil, wenn man in einem Ministerium über mehrere Themen entscheiden und diese «zusammenfügen» kann.
In unserem Bundesministerium sind es immerhin Landwirtschaft, Energie und Tourismus. Diese Verbindung ist eine grosse Chance – öfter aber auch ein Nachteil. Bei Interessens-Konflikten muss ich eine Lösung finden, die für alle Beteiligten passt. Aber da sehe ich mittlerweile den grossen Vorteil, dass ich nur mit mir selbst streiten muss und nicht mit einem Gegenüber.
Reden wir übers Geld: 61 Prozent vom österreichischen Agrar-Budget kommen aus dem EU-Topf. Da ist es leicht, Landwirtschaftsministerin zu sein, oder?
Eher oder (lacht), weil Österreich in der EU ein Nettozahler-Land ist. Das heisst, wir zahlen mehr in die Europäische Union rein, als wir rausbekommen. Das muss man immer berücksichtigen.
Wenn man den Budget-Topf aller EU-Gelder anschaut, fliesst am meisten Geld in die Sozialpolitik, in die Renten, in das Gesundheitssystem sowie in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Landwirtschaft macht da einen relativ kleinen Bereich aus.
Und ein wichtiger Punkt ist: Die österreichischen Konsumenten können dank der EU hochwertige Lebensmittel aus österreichischen Familienbetrieben preiswert einkaufen. Wegen den Importen aus Billiglohn-Ländern mit industrieller Landwirtschaft erhalten wir nämlich Ausgleichs-Zahlungen der EU, ohne die unsere klein strukturierten Betriebe nicht mehr existieren könnten.
In Österreich kommen 20 Prozent der bäuerlichen Einnahmen aus öffentlichen Geldern. Wie werden diese Gelder verteilt, welche Programme für die Landwirtschaft helfen einem österreichischen Bauern, seine Existenz zu sichern?
Wir haben ein anderes Modell als Länder wie Frankreich und Deutschland. Deren Hauptausgleich geschieht über die Fläche und über dass Direktzahlungs-Modell.
Die österreichische Landwirtschaft ist klein strukturiert. Schon vor dem EU-Beitritt hat man festgestellt: Die Hektar-Beträge werden unseren Betrieben im Wettbewerb nicht helfen, weil die Grossbetriebe anderer EU-Länder immer bessere Voraussetzungen haben werden.
Wenn die Landwirte in unseren Berggebieten den Betrieb vergrössern würden, hätten sie in ihren Steillagen immer noch höhere Produktionskosten als ein Ackerbau-Betrieb im Flachland.
Deswegen vergeben wir in Österreich den Hauptteil unserer Zahlungen über das Agrar-Umweltprogramm (ÖPUL). Mit diesen ÖPUL-Beiträgen für Umwelt-, Natur-, Boden- und Wasserschutz haben wir einen sehr hohen Anteil an biologischer Landwirtschaft erreicht. Im Gegensatz zum Fussball ist Österreich in der Bio-Landwirtschaft Weltmeister (Elisabeth Köstinger lacht).
Dazu kommen unsere Investitions-Förderungen und die Unterstützung für Jung-Bauern. Bei uns kriegen Jung-Bauern eine Niederlassungs-Prämie, wenn sie einen Betrieb übernehmen. Das ist ein wichtiges Anreiz-Instrument, ein Startvorteil für Jung-Bauern, die in einen Betrieb einsteigen.
Sie definieren die österreichische Agrarpolitik als ökosozial. Was bedeutet das konkret für den Landwirt?
Unsere ökosoziale Agrarpolitik ist ein klares Bekenntnis zum bäuerlichen Familienbetrieb. Ein Bekenntnis dafür, dass wir auch in Zukunft unsere Lebensmittel in Österreich produzieren wollen. Und das nicht nur in den privilegierten Lagen, sondern auch in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten.
Nur wenn Ökologie, soziale Sicherheit der Landwirte und Marktwirtschaft gleichwertig sind, ist die Landwirtschaft nachhaltig.
Wie sieht die österreichische Landwirtschaft aus, wenn sich der gerade erwähnte Jung-Bauer in zehn Jahren etabliert hat? Ist das dann die Landwirtschaft, die Sie sich persönlich wünschen?
Ich glaube, dass die Landwirtschaft der Zukunft die Kreislauf-Wirtschaft sein muss. Dafür müssen wir regional integrierte Wirtschafts-Systeme aufbauen.
Der Druck der globalen Märkte auf unsere österreichischen Familien-Betriebe ist extrem hoch. Deshalb müssen wir uns ein Stück weit von den globalen Märkten entkoppeln und eigene Modelle schaffen. So gewinnen die bäuerlichen Familien-Betriebe an Widerstandskraft und können den grossen globalen Märkten die Stirn bieten.
Ich will, dass jeder Hektar produktiv genutzt werden kann – egal ob im Berggebiet oder in unseren Ackerbaugebieten. Dass wir die Lebensmittel-Versorgung für Österreich sicherstellen können und vor allem unabhängig werden von Importen. Das ist das grosse Ziel, das ich mit meiner Politik in den nächsten Jahren verfolgen will.
Alle Interviews für «die grüne» werden zunächst im Wortlaut transkribiert und danach – in Absprache mit den Gesprächspartnern – zur besseren Verständlichkeit bearbeitet und wenn notwendig gekürzt.









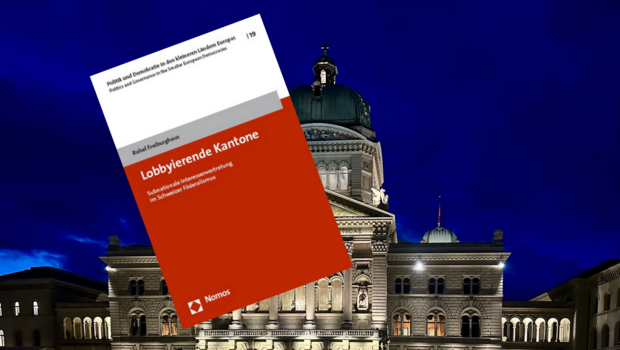






1