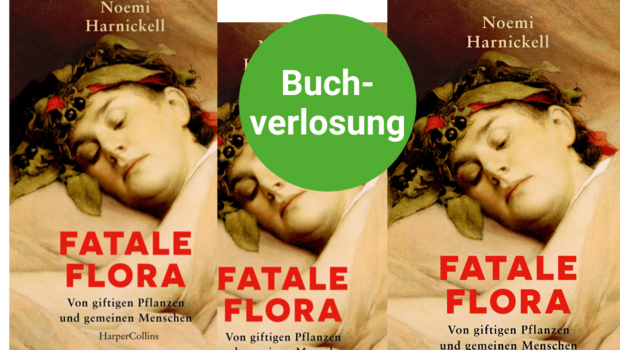Kurz & bündig
- Innerhalb der Gewässerschutzkontrolle werden auch Weideeingänge kontrolliert.
- 2024 gab es trotz der vielen Niederschläge nur wenige Beanstandungen.
- Mit diversen Massnahmen können Weideeingänge trocken und das Futter sauber gehalten werden.
Die Gewässerschutzkontrolle wird im Rahmen einer ÖLN-Kontrolle durchgeführt. Ein Teil davon ist auch die Kontrolle von Weideeingängen, weil matschige Weideeingänge zu Nährstoffeinträgen in Gewässer und Grundwasser führen können. Hier stehen Tierwohl und Gewässerschutz im Zielkonflikt.
Trotz der äusserst regenreichen Weidesaison 2024 gab es gemäss Helena Joss von der Kontrollorganisation Aniterra AG aber kaum Beanstandungen bezüglich Gewässerschutzverstössen mit Weideeingängen. Die LandwirtInnen seien gut auf die Kontrollen vorbereitet gewesen und die Kontrollpersonen agierten entsprechend kulant angesichts der vielen Niederschläge.
[IMG 2]
Verschiedene Massnahmen sorgen für trockene Füsse
Trockene Weideeingänge sind aber nicht nur für die Gewässerschutzkontrolle vorteilhaft, sondern beugen auch Futterverschmutzungen vor. Laufen die Tiere täglich immer an derselben Stelle vorbei, verschmutzen sie mit ihren schlammigen Klauen das umliegende Gras, was zu Futterverlusten führt.
Für Martin Zbinden vom Inforama ist klar, dass es nicht die eine Lösung für saubere Weideeingänge gibt. Er gibt einen Überblick zu verschiedenen möglichen Massnahmen:
- Weideeingang verbreitern
- Auszäunen von matschigen Flächen
- Weideeingänge mit Kies und Ecoraster befestigen
- Alte Spaltenböden im Weideeingang vergraben
- Vorhandene Feldwege für Weideaustrieb nutzen
- Bei Roboter mit automatischem Weidetor einen geordneten Weidegang anstreben
- Dichte Grasnarbe fördern mit Einsaaten
- Holzschnitzel als Deckschicht werden von Tieren gerne akzeptiert
- Weideweg erstellen mit Kies
- Tränken nicht beim Weideeingang hinstellen
- Tränken regelmässig verschieben oder Flächen rund um Tränken und Futterraufen befestigen
- Die Tiere nur zum Fressen auf die Weide treiben, um unnötige Wartezeiten am Weideeingang zu vermeiden
Weidewege mit Holzschnitzeln zu bedecken, ist nur eine provisorische Variante. Die Deckschicht muss jährlich ersetzt werden und ist nicht geeignet für nasse Stellen. Werden morastige Stellen befestigt, kann es sein, dass sich die Matschgrenze weiter verschiebt und sich der Schaden ausdehnt.
Werden Wege neu erstellt und permanent befestigt, sollte man sich vorgängig bei der Gemeinde erkundigen, ob dazu eine Baubewilligung notwendig ist.
[IMG 3]
Weideeingänge mit passendem Weidemanagement schonen
Nebst baulichen Massnahmen kann auch das Weidemanagement den Umständen angepasst werden. So kann beispielsweise das Verschieben des Weideeingangs die Problematik bereits abfedern, sofern der Weidezaun nicht permanent befestigt ist. Kleinere Koppeln mit häufigerem Weidewechsel können die Flächen am Weideeingang schonen.
[IMG 4]
Gewässerschutzpunkt Weideingang
Anforderungen gemäss Kontrollhandbuch:
- Keine grossflächigen, vegetationsfreien oder morastigen Flächen auf der Weidefläche vorhanden.
- Morastige Flächen sind ausgezäunt, neu angesät bzw. die Weideflächen werden regelmässig verlegt.
- Fress-/Tränkebereiche befestigt oder kein Morast sichtbar.
- Keine übermässige lokale Anhäufung von Exkrementen.
Die Anforderungen sind relativ offen formuliert und wurden kantonal spezifisch noch leicht präzisiert. In manchen Kantonen wurde auf eine explizite Quadratmeterangabe verzichtet. Die Flächen werden von den Kontrollpersonen relativ zur Tierzahl beurteilt.
Matschige Weideeingänge bedürfen der Einzelfallbeurteilung. Dabei wird auf die Topografie und sonstige Begebenheiten geachtet. Zudem schaut die Kontrollperson, ob wegen der aktuellen Wetterlage in dieser Region bei anderen Betrieben dasselbe Problem herrscht.